 |
 |
|||
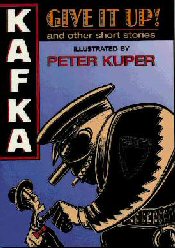
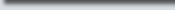
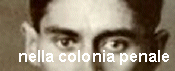
Kafka, Weiber und Kinder
fast ein Aufsatz, von Anna Glazova
Schon beim ersten Treffen und vom ersten Blick wurde Franz Kafka vor Felices ungeheuren Zähnen wie festgebannt - was für ein wunderbares Gebiß, was für eine Glücksgarantie, die erste Liebe, das gefallene Urteil. Die preußische Jüdin Felice stand aber hart und getreu auf dem Boden und kümmerte sich eher um praktische Angelegenheiten. Kafkas Diät kam ihr gleich einer kindlichen Laune vor, und sie beabsichtigte schon seit langem, den Schuft mit ihrer gewichtigen Hand zu züchtigen. Diese Hand vervollständigte den Arm, der aus dem unlangen Ärmel einer sorgfältig bestickten Bluse herausprallte, deren Schnitt im älteren Kafka, diesem schlauen Modisten, den bürgerlichen Jüdhaß, geschweige den professionellen Neid erregte. Sie saßen am Tisch. Franz senkte seine Augen und starrte auf seinen Teller; er grübelte darüber nach, ob Felice eine ausreichende Stütze für sein Gerippe bilden könnte, denn seine Knochen waren zu groß, im Vergleich zu dem fast unwägbaren Körper. Franz aß kein Fleisch gleich wie ein Säugling kein Brot ißt – ein Säugling braucht die mütterliche Milch und Sänfte. Und nachdem die karg ausgestellten Zärtlichkeiten der slawischen und sonstigen Nutten Franz überdrüssig gemacht hatten, brauchte dieses schnell entwickelte Kind nur die Milch für ganz Erwachsene. Unter dem Teller voll dünnflüssiger Suppe lag eine Postkarte an Felice verborgen, in der Franz seinen gebrechlichen, unhaltbaren Blutdurst mit der Schamlosigkeit eines Kindes beschrieb; sein ausgemagertes Körperlein schrie wörtlich nach Blut. Wer weiß, was Felice sich dachte, wenn sie diese Vignetten der art nouveau bekam, diese Pensees in einer floralen, reichlich verzierten Handschrift. Vielleicht fuchtelte sie einfach unter der Nase mit ihrer üppigen Hand, als wollte sie eine Mücke verscheuchen. Der bleiche Franz jedoch träumte immer fort von ihrem rosigen Hals. Hermann Kafka, der Vater, sog die Suppe in sich hinein, indem er mit wachsender Empörung das bleiche Gesicht des Sohnes beobachtete: die Arbeit der Einbildungskraft zog alle Farbe - die diabolische Tinte! - aus diesem Gesicht. Er warf seinen Löffel weg, da er außerstande war, das Geschehende weiter auszuhalten; die Mutter zuckte zusammen und trat eilig in die Küche hinaus. Hermann riß die Hosenträger von seiner Brust und schlug mit ihnen geräuschvoll gegen die Lehne eines Wienerstuhls. Franz versteckte die Postkarte auf seiner Brust, schlüpfte unter den Tisch, seine auf den Vater gerichteten Augen blitzten von dort unten, während er selbst ein wenig und leise heulte. Papa war gegen so eine Heirat. Felice war ein großes und gescheites Mädchen, bedrohte also seine Autorität.
Felice hatte eine jüngere Freundin, die Grete Bloch. Gretes Schönheit verfloß in Tränen zwischen den Zeilen jedesmal, wenn sie an Franz darüber schrieb, was Felice von ihm erzählte. Kafka antwortete, indem ihn Genußkrämpfe packten, deren Ursache in diesen epistolarischen Seitensprüngen bestand. Der Briefwechsel überstrahlte die persönlichen Begegnungen, die mit Ächzen und Seufzen vollgefüllt waren und die Grete sentimentalerweise von Felice geheimhielt. Genauso weinte sie 25 Jahre später, als sie an Max Brod schrieb - Kafkas unaufhaltsames Fantasieren beeinfloß auch ihre Denkweise. In diesem Brief entfesselten sich ihre schriftstellerischen Kapazitäten; sie schilderte – wenn auch nicht sehr glaubenswürdig – einen Protagonisten, einen schwächlichen, schwindsüchtigen Siebenjährigen, angeblich den Sohn ihrer und Kafkas Liebe. Franz prägte sich in ihre Erinnerung als ein enfant fragile, dessen Lebensfrist immer kürzer wurde mit jedem Male, wenn sie ihn fest an ihre Brust drückte. Er entfloh den beiden Freundinnen: sie kamen zu nah, und es dämmerte ihm schon, daß sein Leben sich nicht in die Länge ziehen würde, es wäre also eine reine Unvernunft, die kostbare Zeit bei diesem vergänglichen Fleisch zu verschwenden.
Kafka las Mirbeau. Er entdeckte den literarischen Masochismus und machte mit dem körperlichen Laster Schluß, um sich in die psychische Unzucht zu begeben: diese letztere benötigte mehr Kräfte und ermattete süßer. Er bildete sich die Schwindsucht ein und übte die Krankheit auf eine geniale Weise aus, indem er sie erst aus dem Kopf in die Lungen und dann weiter in die Nerven zwang. Im Sanatorium klopfte er an die Decke, um die kleine minderjährige Schweizerin zu wecken, die dort oben wohnte, und ihr daraufhin seine Fabeln in der Nacht durch das offene Fenster zu erzählen. Sie verstand wohl nicht alle Worte, allerdings wurde es ihr trotzdem irgendwie bewußt, worauf er mit diesen Allegorien hinauswollte, und ihr Gesicht errötete gänzlich trotz seiner tödlichen Bleiche. Kafka war zufrieden. Das Spiel gefiel und gelang ihm.
Im selben Augenblick fiel ihm Milena ein, oder genauer gesagt, nicht sie selbst, sondern ihr modisch geschnittenes Kleid aus feinem Musselin, das sie eines Tags vor langer Zeit, an einem heißen untätigen Nachmittag anhatte, als Kafka, zu dem Zeitpunkt noch ein Geck und Flaneur, Hoffmannstahls eifriger Lehrling, sie, die Modejournalistin, in einem Literatenkaffeehaus erblickte. Kafka schrieb einen Brief an Milena. Zu dieser Zeit hatte er seine Erzählung „In der Strafkolonie“ schon seit langem verfaßt; es ging dort darum, die ornamentalische Schriftweise des Jugendstils zu brandmarken –im durchaus wörtlichen Sinne. Nach der Theorie des Architekten Adolf Loos, der ein großer Schätzer der reinen Rasse war, sind Ornamente das chrakteristische Merkmal für primitive Südzivilisationen. Nach der Theorie des Antropologen Cesare Lombroso sind Tätowierungen nichts anderes als die verkörperten Ornamente der Graphomania, die bekannterweise die Krankheit der Kriminellen ist. In der Strafkolonie verrichtete Kafka das Primitive an seiner eigenen Halb-Literakundigkeit, indem er ihr Triebwerk – die Schreibmaschine größer als das Leben - zunichte machte. Der Brief an Milena wurde folgendermaßen schon in einer neuen Handschrift aufs Papier gebracht, die auch Generationen später eine mystische Schauder in den Literaturkritikern erzeugt, sodaß das Manuskript „Der Prozeß“ vor ein paar Jahren für $2 000 000 versteigert werden durfte; eine solche Summe wäre fast der heutigen Mystery-Helden vom Schlage Stephen King würdig.
In klaren und schlanken, nach links geneigten, von jeglicher Spur Putz freien Buchstaben, die jedoch mit schwarzen Umlauthörnchen und Kommatahüflein versetzt waren, lud Franz Milena auf seine literarische Folterinsel ein, in deren Mitte sich „ein eigentümlicher Apparat“ erhob – Kafkas kranke und krankhafte, schnell und erotisch vibrierende Fantasie. Milena, die durch die dekadenten Romanen zum Thema femme fatal und die unverhüllten Affären ihres Mannes verdorben war, erklärte sich fast ohne Umschweife zu einer Wüstenration aus Heuschrecken und verlockenden Fata Morganas bereit. Franz, der durch alle Schmerzregionen seiner eigenen Psyche gewandert hatte, wußte genau, wo zu berühren und wo zu drücken – er war ein raffinierter platonischer Liebhaber. Öfter lag er am Nachmittag in einem Boot in den Armen von abwechselnd Max Brod und Julie Wohryzek (der Arbeitstag eines österreichischen Beamten hörte schon um Mittagszeit auf) und erfand die Ausdrücke für den nächsten Brief – zum Beispiel, darüber, wie ihn die Schlaflosigkeit oder der Gedanke an Milenas Verheiratet-Sein quält (nach zwei Jahren schied sie sich zu guter Letzt von ihrem Mann). Darüber, wie gern er in Wien sein wollte, was aber wegen seiner Beschäftigung im Büro unmöglich wäre, da er bis spät nachts auf der Arbeit sein müßte. Darüber, daß Milena auf keinen Fall ihr Schicksal an das seine knüpfen durfte, weil er arm, krank, "alt und grauhaarig" (mit 35 Jahren), Jude wäre, und das "könnte gefährlich sein", während ihr damaliger Ehegatte Ernst Pollak auch jüdischer Abstammung war und Kafka davon, natürlich, wußte. In solchen Minuten stellte Kafka sich die den Brief lesende Milena vor und heulte mitleidig, und Max, falls es ihn im Boot gab, putzte seine Brille in Verlegenheit; falls es Julie im Boot saß, die übrigens den gleichen Vornamen wie Kafkas Mutter trug, so fuhr sie dem unartigen Knaben mit der Hand durchs Haar und sang ihm ein Wiegenlied. Jeder von ihnen, Max, Julie und Milena, hielt sich für Kafkas wichtigste Vertrauensperson. Er antwortete auf ihr Vertrauen ähnlicherweise: er vertraute sich auch völlig. Franz schrieb – Milena antwortete. Wenn die Briefform zu eng für sie beide wurde, so schrieben sie: er schrieb sich selbst, den literarischen Nachlaß von Franz Kafka, sie schrieb ihn, den literarischen Nachlaß von Franz Kafka auf Tschechisch. Im imaginären wüsten Raum, der Prag von Wien mit einem undurchgänglichen, erhitzten Niemandsstreifen trennte, zeugten Franz und Milena eine Menge Literaturdämonen - es waren die Sprößlinge jenes "Vertrags mit dem Teufel", wie Gilles Deleuze ihre Beziehung nannte. Der Strom der Briefe ließ langsam nach, dann wurden die Briefe ganz selten, dann fingen die beiden wieder an, einander zu siezen, aber den letzten Brief schickte Franz an Milena noch kurz vor seinem Tod. Als Milena, die Franz auf einiges überlebte, wegen der Sympathie mit den Jüden ins Ravensbrucker KZ verbracht wurde, wo sie an einer sogenannten mißlungenen Nierenoperation starb, kamen ihr diese blauäugigen Dummköpfe mit Swastika auf dem Bierbauch wie stumpfe Amateure vor.
Kafkas letzte Liebhaberin war eine gewisse junge Dora Diamant, die noch jünger wirkte und eine emanzipierte Jüdin war. Es war die zweite (nach der Mutter) Frau in seinem Leben, mit der er bereit war, unter demselben Dach zu leben. Die Schwindsucht, aus der Kafka so viele seelische Kräfte schöpfte, zerfraß nun langsam seinen Körper. Zu diesem Zeitpunkt wog er 45 kg, wobei er 182 cm in Größe maß. Dora, die nicht gerade mager war, könnte ihn mit Leichtigkeit auf den Armen tragen, wenn sie es nur wünschte. Sie kaufte ihm Blumen und Tinte. Als er starb, heiratete sie, empfing ein Kind und brachte ein Mädchen zur Welt, das nur sieben Jahre lang lebte. Doras Mann wurde im KZ umgebracht. Sie, die sich selbst Dora Kafka nannte, führte danach ein langes und einsames Leben. Was Franz angeht, schaffte er es noch, als er im Sterbebett lag, einen Arzt in die Hölle mit einer eleganten Geste mitzunehmen: er litt schrecklich an unerträglichen Schmerzen und flehte darum den Arzt an, ihm eine letale Morphiumsdosis zu geben; der Arzt verzichtete. Kafkas letzte Worte waren: "Töte mich, oder du bist ein Mörder". Er genoß es, das Leben mit dem Tod blindlings zu vertauschen. Er machte es so oft, daß das Leben und der Tod für ihn letzten Endes zu Synonymen wurden. Kafka hatte keine Kinder, und Frauen hatte er eigentlich auch keine.

